In der heutigen FAZ wird gefragt "Schützt uns die Demokratie?".
»Was, wenn sich die Lage so zuspitzt, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung gegen das System wendet, das von ihrer Risikoeinschätzung abhängig war? Sind die komplexen demokratischen Verfahren überhaupt in der Lage, vor außergewöhnlichen Bedrohungen wie der einer weltweiten Seuche zu schützen?
Demokratien unter Legitimationsdruck
Die Frage verschärft sich durch den geopolitischen Wettbewerb. China schlachtet seine Erfolge im Kampf mit dem Virus propagandistisch aus und präsentiert sie als Beweis der Überlegenheit seines autoritären Systems. Die Antwort darauf liegt auf der Hand: Diktatorische Methoden wie die der Volksrepublik kommen für einen Rechtsstaat nicht in Frage…«
Klar ist für einen FAZ-Mann, daß die chinesische Lösung nicht in Frage kommt, denn China ist ja eine Diktatur. Die autoritäre Lösung in Neuseeland und Südkorea erscheinen ihm hingegen vorbildlich, schließlich sind das Demokratien, wenn er dazu auch feststellen muß:
»In Südkorea wertet der Staat die Handy- und Kreditkartendaten von Infizierten aus und veröffentlicht ihre Bewegungsprofile im Internet.
Ausschlaggebend für den Erfolg war in allen drei Ländern die Rolle der Gesellschaft. Es gab auch dort Kritik und Debatten, aber die Erfahrung mit früheren Epidemien führte offenbar zu einem großen Konsens, was die Risikoeinschätzung betrifft.«
Er sieht nicht das Problem, daß hierzulande Erfahrungen im Umgang mit behaupteten Epidemien (Propagandist stets C. Drosten) wie Schweine- oder Vogelgrippe oder SARS ebensowenig zu "einem großen Konsens" führen wie das zunehmend autokratische und die "freiheitliche Demokratie" verhöhnende Vorgehen bei Corona.
Rechtliche Grundlage, ja, aber…
»Deshalb ist es gut, dass der Bundestag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes berät, das einzelnen Verordnungen wie Abstandsgeboten, Reisebeschränkungen und Maskenpflichten eine rechtliche Grundlage geben soll. Gerade erst hat der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers daran erinnert, wie sehr die Einbeziehung des Parlaments die demokratische Legitimation erhöht, wodurch dann auch die Chance größer wird, dass die dort getroffenen Mehrheitsentscheidungen von der Bevölkerung akzeptiert werden: „Abgeordnete vertreten ungeachtet parlamentarischer Arbeitsteilung stets das ganze Volk, während Regierungen sich bewusst entlang eigensinniger ministerieller Ressortlogiken organisieren.“«
Gut und schön, aber man muß "noch weiter" gehen, nämlich weit zurück:
»Noch weiter geht die Forderung, die der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung jetzt nach der gerichtlich genehmigten „Querdenken“-Demonstration und den Ausschreitungen in seiner Stadt erhob. Er wünschte sich eine grundsätzliche Debatte und rechtliche Klärung der Frage, welches der grundgesetzlich geschützten Güter höher zu werten sei: die Versammlungsfreiheit oder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Mittelfristig läuft das auf die noch umfassendere Debatte hinaus, wie der demokratische Staat seine Prinzipien mit dem wirksamen Schutz vor Bedrohungen außerhalb seiner Routinen verbinden kann.«
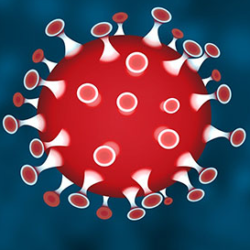
lesen Sie ja keine FAZ
Mit den Überlegungen, die die FAZ da von sich gibt, werden wir ja nun schon eine ganze Weile traktiert. Steter Tropfen höhlt den Stein ist da die Devise, scheint mir. Dass man aber aus der gleichen Liga der herrschaftsaffinen Blätter manchmal auch andere Töne zu hören bekommen kann, zeigt die NZZ, wenn sie vom Herrenreitertum mancher Politiker redet. Da kann man dann auch mit den üblichen verdächtigen Beimengungen leben:
https://www.nzz.ch/meinung/befehl-und-gehorsam-sind-in-der-corona-krise-zurueckgekehrt-ld.1586610