Lars Jonas Holger Gardell (* 2. November 1963 in Enebyberg, Gemeinde Danderyd, Schweden) ist ein schwedischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Schauspieler, Komiker und Sänger (Wikipedia). Er hat diesen Text am 29.12 in der schwedischen Boulevardzeitung "Expressen" veröffentlicht (Danke für die Übersetzung an eine Leserin!):
»Nach fast einem Jahr mit Covid-19 erscheinen der alte Alltag und die Realität als ein Traum, während soziale Distanz und Isolation zur Norm geworden sind.
Jonas Gardell schreibt darüber, was Einsamkeit mit dem Menschen macht – und über die Hoffnung, die mit dem Licht kommt.
Text: Jonas Gardell
Veröffentlicht am 29. Dezember 2020 um 13.12 Uhr
ESSAY In diesem Frühjahr verlor Mark seine Mutter. Vielleicht hast Du, der du dies liest, auch jemanden verloren, der dir im ausgehenden Jahr nahe stand. Diejenigen, die nicht mehr da sind, hinterlassen eine Lücke voller Trauer und Verlust.
Wir beenden 2020 in Dunkelheit. Mit Tagen, die bestenfalls grau sind und in einer Art Halbdämmerung vergehen.
Im Dezember hatten wir in Stockholm bisher so gut wie keine Sonnenstunde. Nahe Null. Fast keine einzige. Ich denke, wir sind sehr tapfer und begabt, das auszuhalten. Auf Pressekonferenzen erhalten wir jeden Tag neue düstere Todeszahlen und neue düstere Prognosen, zusammen mit einer Portion Schelte von strengen Ministern, Ärzten für Infektionskontrolle und jedem, der uns sonst noch an dem Tag gerade eine Lektion erteilen möchte.
Dafür, dass wir schlechte Menschen sind und nicht artig genug uns voneinander zu isolieren, weil sich das Virus immer noch ausbreitet, das Virus, welches die ganze Welt zerfließen ließ, eine Welt, die durcheinander geschüttelt und auf den Kopf gestellt wurde.
Ich mache meine täglichen, sehr einsamen Spaziergänge und versuche dafür die Tageszeit abzupassen in der es hell ist, mit dem vagen Gedanken, dass Tageslicht und Bewegung Depressionen entgegenwirken sollen. Jedes Mal wenn ich jemanden treffe machen wir unsere traurigen Corona-Pirouetten um Abstand zu halten, schauen auf den Boden und nehmen uns voreinander in Acht. Letztes Wochenende ging ich mehrmals an einer Gruppe Menschen vorbei, die sich im Freien zum Glühweintrinken versammelt hatten. Mit Weihnachtsmützen auf, damit es sich wenigstens etwas festlich anfühlt, standen Sie in einigem Abstand voneinander im Matsch und trampelten mit den Füßen, um sich warm zu halten. Ich denke, wir verdienen eine Medaille vom König und nicht nur die Schelte von Löfven (schwed. Ministerpräsident, d.Ü.), aber das bin wohl nur ich, der das denkt.
Was wir alles machten ohne darüber nachzudenken. Was wir alles für selbstverständlich hielten. Es scheint alles so weit weg.
Ich gehe und gehe, bei Regen und Kälte, in immer größerer Trostlosigkeit, in einem herbstlichen Winter, in dem ein Tag wie der andere ist. Wenn ich nach Hause komme ist es nicht später als drei Uhr nachmittags und es beginnt schon dunkel zu werden.
Der größte Teil meines Lebens ist abgesagt, verschoben und "put on hold". Sortiere Bilder auf dem Computer, um etwas zu tun zu haben. Wie in den meisten Familien sind es hauptsächlich Kinder‑, Sommer- und Urlaubsfotos. Bilder von glücklichen Tagen, unbeschwerten Tagen. Mit Freunden grillen, dicht gedrängt miteinander vor der Kamera posierend, Arme um die Schultern des anderen, Familien mit Kindern, die zusammen picknicken, Wein bei Sonnenuntergang.
Was wir alles machten ohne darüber nachzudenken. Was wir alles für selbstverständlich hielten. Es scheint alles so weit weg.
Die Pandemie hat Brei in mein Gehirn gegossen. Es ist, als ob ein Spannungskopfschmerz mein normales Denken blockiert. Bin begriffsstutzig, sage oft das Falsche, mir fehlen Worte. Ich denke ich bin damit nicht allein. Vor allem die Wahrnehmung der Zeit ist völlig durcheinander geraten. Die Zeit seit März ist wie überdehnt. Schwer zu erinnern, was vorher war und wann. Ich konzentriere mich so stark ich kann, bekomme aber nur Kopfschmerzen davon.
*Alles, was früher mein Alltag und meine Realität war, erscheint wie ein Traum, während dieser Albtraum, in dem wir jetzt leben, allmählich Normalität wird. Ich möchte nur, dass es vorbei sein soll. Dass jemand sagt, dass es bald vorbei ist.*
Aber die schwedischen Behörden und Minister reichen nicht einen Finger, nicht einen Strohhalm: Es ist noch lange nicht vorbei. Nicht einmal der Impfstoff bringt einen echten Hoffnungsschimmer. Es war sogar ein Regierungsbeamter der sich geäußert hat und sagte, dass es keine Rückkehr zur Normalität gibt. Corona ist die neue Normalität.
Schließlich rief er seine Mutter an und fragte traurig, ob es jemals schlimmer war als jetzt.
Ich denke an den zwanzigjährigen Sohn eines engen Freundes, der im August diesen Jahres ein Studium an der Universität Göteborg begonnen hat. Mietete einen kleinen Waschkeller in Angered und zog nach unten. Kannte niemanden in Göteborg, aber das sollte sich wohl finden. Es war der Moment, in dem alles beginnen sollte. Sein Erwachsenenleben.
Er war voller Erwartungen. Würde neue Freunde finden, vielleicht eine Freundin kennenlernen, eine neue Stadt erkunden, damit beginnen, seine Identität als Erwachsener zu schaffen.
Jetzt im Dezember hat er ein ganzes Semester lang isoliert in seinem Keller vor dem Bildschirm gesessen. Sämtliche Vorlesungen nur digital. Einsam wie nie zuvor. Von Zeit zu Zeit wurde ihm von einem Minister oder einem Arzt für Infektionskontrolle eine Standpauke gehalten, dass die Jugend mehr Verantwortung übernehmen müsse. (Oh, kann nicht jemand schleunigst den jungen Leuten ernsthaft für all das danken, was sie opfern mussten! Wir anderen opfern ein paar Monate unseres Lebens, sie riskieren ihre gesamte Zukunft!)
Schließlich rief er seine Mutter an und fragte traurig, ob es jemals schlimmer war als jetzt.
Was sollte sie ihm antworten?
Als sie in seinem Alter war, drohte die Welt durch den Kalten Krieg und das nukleare Wettrüsten unterzugehen. Mittelstreckenflugkörper hatten ihre nuklear bewaffneten Köpfe auf alle europäischen Städte gerichtet. Von Zeit zu Zeit wurde in den Zeitungen eine Weltuntergangsuhr veröffentlicht, ein bisschen so ähnlich wie jetzt Todeszahlen veröffentlicht werden, und sie stand wenige Minuten vor Mitternacht. Um "Mitternacht" wäre es zu spät.
Zudem breitete sich die AIDS-Panik aus. Die Krankheit wurde als die neue Pest beschrieben. Die Sterblichkeitsrate, wenn du dieses Virus haben solltest, war 100 Prozent. Aber zum Glück wurden fast nur Homosexuelle angesteckt, so dass es auf gewisse Weise akzeptabel schien.
Die soziale Isolation, Einsamkeit, das Gefühl der Trostlosigkeit und Verlassenheit, die 2020 geprägt haben, ist neu.
War es in den 1980er Jahren nicht schlimmer als heute?
Oder als die Eltern meines Freundes in den 1930er und 1940er Jahren Kinder und Jugendliche waren. War es da nicht unglaublich viel schlimmer?
Seinerzeit wurde die Welt von Hitler und Stalin, Nazismus und Kommunismus, bedroht. Der Zweite Weltkrieg kam mit Verdunkelungen und Rationierungen in Schweden, und in Deutschland und Polen wurden nur wenige Kilometer von der geschlossenen schwedischen Grenze entfernt Vernichtungslager errichtet.
In vielerlei Hinsicht waren diese Jahre natürlich viel schrecklicher und verheerender als 2020.
Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Weder wir noch unsere Eltern mussten sich vor anderen in Acht nehmen. Wir gingen zur Schule, wir konnten weiterarbeiten. Wir konnten uns treffen und uns verlieben. Wir durften uns umarmen. Wir konnten tanzen, ins Kino und ins Theater gehen. In einem Chor singen. In die Kirche gehen. Wir konnten füreinander da sein. Hochzeit feiern. Unsere Toten mit Würde begraben. Feiern, dass wir die Schule geschafft haben. Im Lucia-Zug mitgehen. Um den Weihnachtsbaum tanzen. Sich im Skansen treffen und die Neujahrsglocke läuten hören.
Mein Gott, in den 1980er Jahren wäre die Welt vielleicht untergegangen, aber wir konnten immer noch zusammen mit hunderttausend anderen an großen Demonstrationen teilnehmen.
Die soziale Isolation, Einsamkeit, das Gefühl der Trostlosigkeit und Verlassenheit, die 2020 geprägt haben, ist neu.
Und es ist eine Isolation, die sich in uns hineinfrisst.
In der Bibel steht geschrieben, dass Gott als er am Anfang die Welt schuf immer wieder auf das schaute, was er erschaffen hatte, und dass es gut war. (tov)
Er schuf das Licht und sah, dass es gut war. Er schuf Land und Meer und sah, dass es gut war. Er schuf viel Grün, samenhaltige Kräuter und verschiedene Arten von Obstbäumen, er schuf Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne, er schuf alle Tiere und schließlich den Menschen und jedes Mal, wenn er sich ansah, was er geschaffen hatte, war es gut.
Diese Formel wird in der Schöpfungsgeschichte sieben Mal wiederholt, fast wie ein Mantra. Es ist als ob der Text uns in Zeiten der Sorge, in Zeiten der Trauer, des Schmerzes und des Elends einhämmern will, dass die Welt, die Existenz, die uns umgibt, dem Grunde nach gut ist.
Doch als Gott Adam erschuf heißt es, dass er auf das schaute was er geschaffen hatte und es nicht gut (lo-tov) für den Menschen sei, allein zu sein.
Einsamkeit ist also das erste, was nicht gut ist.
Die ständigen Ermahnungen des Jahres 2020 mit denen wir aufgefordert werden, uns zurückzuziehen und zu isolieren – ich verstehe, dass sie notwendig waren und sind, aber ich weiß auch, dass das auf lange Sicht nicht gut für uns ist.
Der Schöpfungsbericht der Bibel ist über 2.500 Jahre alt, aber schon damals wusste der Mensch, dass er mit anderen zusammen sein muss.
Der physische Kontakt zwischen Menschen ist überlebensnotwendig.
Wir brauchen es, zusammen zu sein. Wir sind dafür geschaffen, mit anderen zusammen zu sein. Wir werden zu Menschen in der Begegnung mit anderen Menschen.
In der Tele 2 Arena eng zusammensitzen, wenn Djurgården ein Tor erzielt und alle wie ein Mann aufspringen und jubeln und sich umarmen. Sich in einem überfüllten Nachtclub schwitzig tanzen. Sich in der Oper treffen und Alexander Ekmans neue Tanzperformance sehen. Dicht am Norra Brunnen stehen und schallend über einen neuen Komiker lachen, während wir versuchen, kein Bier auf unseren Nachbarn zu verschütten.
Auf all das zu verzichten war schwer, und es geht um etwas viel grundlegender Menschliches, als nur darum Spaß haben zu wollen.
Zusammenzukommen um zu lachen, eine Träne zu verdrücken, zu spielen, zu tanzen und Dinge zusammen zu erleben, macht uns menschlich.
Oh, das ist es, wovon ich mir wünsche, dass Stefan Löfven es uns in seiner Rede an die Nation gesagt hätte. Dass wir dafür kämpfen!
Jetzt sind wir müde und erschöpft. Im Gesundheitswesen, weil sie gezwungen waren, viel zu hart zu arbeiten und ständig über die Grenze dessen zu gehen, was sie eigentlich aushalten können. Viele andere sind erschöpft weil sie nicht arbeiten dürfen. Entlassungen, Kündigungen und Insolvenzen. Zerstörte Pläne und Hoffnungen, jahrelange Arbeit und Vorbereitungen, die den Bach runter gingen, Menschen, die gezwungen sind, ihre Häuser zu verkaufen, zerstörte Lebenswerke, junge Menschen, die die Schule verlassen, ohne die Chance zu haben, einen Job zu bekommen.
Ich wünschte, Stefan Löfven wäre besser darin, uns Hoffnung zu geben als er es tatsächlich ist. Denn in der Politik geht es nicht nur darum den Alltag zu verwalten, sondern auch darum, eine Zukunft zu wollen.
Ohne Hoffnung schaffen wir nichts. Ohne eine Vision dessen, was danach kommt und dass es sich für dieses danach zu kämpfen lohnt.
Wir haben keine Zukunft, wenn wir nicht von ihr träumen.
Die Botschaft von Weihnachten ist Hoffnung. Das Versprechen, dass wir einen Ausweg finden. Die in der Dunkelheit wandeln werden ein großes Licht sehen.
In der Weihnachtsnacht kommen die Engel zu den Hirten, um jubelnd zu verkünden, dass der Erretter geboren wurde. Die Rettung ist hier. "Die Dunkelheit flieht, der Tag bricht an!" wie wir in der Christmette singen. (Es ist im Übrigen völlig unbegreiflich, dass es der Kirche nicht gelungen ist, während der Pandemie eine wichtigere Rolle zu spielen.)
An das Jahr 2020 werden wir uns als Albtraum erinnern.
Man könnte es aber auch so sehen: 2020 war auch ein Jahr, in dem die Menschenheit inmitten der schlimmsten Krise seit Menschengedenken mit Wissen und Zielstrebigkeit zusammenkam und es schaffte, einen Impfstoff zu entwickeln, der ihr wieder aus der Dunkelheit helfen kann.
Die Botschaft von Weihnachten ist Hoffnung. Das Versprechen, dass wir einen Ausweg finden. Die in der Dunkelheit wandeln, werden ein großes Licht sehen.
Also setze ich stur meine langen, grauen Einsamkeitsspaziergänge fort. In ein paar Monaten bin ich vielleicht an der Reihe, meinen Impfstoff zu bekommen. Dann werde ich nicht mehr einsam sein. Es wird sich am Ende alles einrenken.
Wir haben keine Zukunft, wenn wir nicht von ihr träumen.
Jonas Gardell ist Autor, Künstler und Mitarbeiter der Kulturseite von Expressen.«
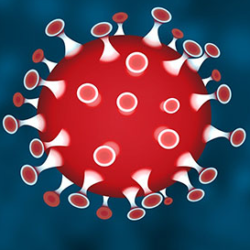
An das Jahr 2020 werden wir uns als Alptraum erinnern…
Bis dahin d'accord…
Aber danach…wie enttäuschend und naiv…
Fast mein Alter,ich bin '57er,
hat er keine kritischen Fragen?
Oder bekommt er das letzte Kapitel üppig bezahlt?
Da wäre er nicht der einzige, wie man in diesem unseligen Jahr lernen musste…ich fand es wirklich albern und überheblich,am Anfang,das Wort Schlafschafe,find ich eigentlich immer noch…
Aber mir fällt leider grad nichts besseres ein. Ich verstehe,dass man nicht so gern aus einem schönen Traum aufwacht.Leider geht das jetzt aber nicht mehr anders,für mich jedenfalls ist es zu spät.Ich sorge mich nun darum,dass meine beiden Töchter und mein Enkel nicht ihr Heil in einer unerforschten und obskuren Impfung suchen,dafür würde ich grade meine Sehnsucht nach Livekonzerten,Reisen und Kulturerlebnissen eintauschen!Und Grundrechte,kein Wort darüber,ach je,Künstler und Autor,da fehlt mir einfach zu viel…
Wenn man es wörtlich nimmt, könnten die letzten Absätze keine bessere Werbung für das Impfen sein.
Um es so zu sehen müsste man aber willentlich die vorher ausführlich geschilderte Verzweiflung über die gegenwärtige Situation ausblenden. M.E. macht der Autor keine Werbung fürs Impfen, sondern bemüht sich unter Zuhilfenahme der Bedeutung von Weihnachten darum, seiner durch die Maßnahmen verursachten Depression etwas entgegenzusetzen. Der Dunkelheit der Depression setzt er die weihnachtliche Hoffnung auf Licht (hier auch im tatsächlichen Sinne der wieder länger werdenden Tage) entgegen.
In dem Sinne lese ich seine abschließenden Worte, dass er vielleicht in einigen Monaten seine Impfung bekommen und dann nicht mehr einsam sein wird , weil sich dann alles wieder einrenkt, als die resignierte Beschreibung des ihm von der Politik zugedachten Schicksals, dass er in Ermanglung besserer Aussichten zu ertragen hat, weil andere Maßnahmen zur Beendigung der gegenwärtigen Situation scheinbar nicht angestrebt werden.
@Kirsten
Er ist aber schon coronagläubig, der Autor:
»Die ständigen Ermahnungen des Jahres 2020 mit denen wir aufgefordert werden, uns zurückzuziehen und zu isolieren – ich verstehe, dass sie notwendig waren und sind«
Bloß weil andere Maßnahmen nicht angestrebt werden (wie Sie schreiben), muß man sich dem Narrativ und der Imfpung nicht beugen!
@Tiffany
Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht.
Aber auch Menschen die an Corona glauben, sind Menschen und dürfen ihre Meinung äußern, oder?
Und sich mit seiner Meinung außerhalb des gesellschaftlichen Narrativs zu positionieren ist in einer hochgradig konformistischen Gesellschaft wie der schwedischen, in der die Idee des Volks als eine große Familie ("folkhemmet") seit mehr als vieri Generationen den Kindern bereits in Kindergärten und Schulen vorgelebt wird, sicherlich noch schwerer als hier bei uns.