Oliver Lepsius ist Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im Feuilleton(!) der FAZ von heute unterzieht er den Lockdown einer vernichtenden Kritik. Es ist die Rede von Hexenprozessen und vom Recht, ohne Maske zu demonstrieren.
»KRITIK AN PAUSCHALREGELUNG:
Lockdown ohne Kontrolle
Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist im November ein neuer Ansatz gewählt worden, der nicht mehr auf Verursachungsbeiträge des Einzelnen (AHA-Regeln) oder die Verantwortung des Betreibers von Einrichtungen (Hygienekonzept) abstellt, sondern ohne Ansehen von Wirkungsketten die Kontaktaufnahmen pauschal reduziert, indem ein gesellschaftlicher Bereich namens Freizeit und Unterhaltung geschlossen wird. Dies führt zu einer einseitigen Lastenverteilung. Sie wird zwar finanziell abgefedert, doch während Dax-Unternehmen weiter Gewinne machen, dürfen es Einrichtungen, die dem sozialen Leben dienen, gerade nicht.
In erster Linie wirkt sich der Lockdown aber sozial aus, und in dieser Hinsicht ist seine Verhältnismäßigkeit zu diskutieren (das verlangt neuerdings auch Paragraph 28a Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes): Wird die Gastronomie geschlossen, kommt das Vereinsleben zum Erliegen, können Verwandte nicht übernachten – betroffen sind also nicht nur Freizeit und Unterhaltung, sondern die Vereinigungsfreiheit und der Schutz der Familie. Werden Fitnessstudios oder Schwimmbäder geschlossen, leidet darunter die Gesundheit gerade auch der Älteren, die sich dort ihre Beweglichkeit erhalten und kaum aufs Joggen verwiesen werden können.
Vom Lockdown betroffen ist also auch die Volksgesundheit. Solche Effekte haben eine schichtenspezifische Komponente: Wer ein Haus mit Gästezimmer und Schwimmbad besitzt, wird weit weniger betroffen als wer in drei Zimmern wohnt. Freiheit kann nicht ökonomisch kompensiert werden, so anerkennenswert staatliche Hilfspakete sind. Wir sind hier im Verfassungsrecht, nicht im Privatrecht. Es gibt grundrechtlich kein „Dulde und liquidiere“, wie Juristen sagen, also kein: Nimm es hin, solange du entschädigt wirst…
Pauschale Verbote, rechtliche Rückschritte
Der im November verhängte, in den Dezember verlängerte Lockdown hat uns gegenüber der im Oktober erreichten Auswahl effektiver Strategien und dem Niveau der Rechtfertigungsdiskussion einen Rückschritt gebracht. Diffuses Infektionsgeschehen erschwerte die Nachverfolgung. Dadurch geriet auch die Evidenz der Maßnahmen aus dem Blick. Es wird nicht mehr primär danach gefragt, welchen Beitrag der Einzelne zur Risikoreduzierung erbringen kann, sondern pauschal ohne Ansehen individueller Präventionsleistungen ein ganzer Bereich stillgelegt, der schon terminologisch als Freizeit und Unterhaltung relativiert wird. Wenn Kontakte nach Schulschluss und Feierabend unterbleiben, so ist die Grundlogik, dann reduziert dies das tägliche Infektionsrisiko pauschal.
Diese Strategie ist Ausdruck einer Hilflosigkeit. Auf diffuses Infektionsgeschehen wird mit diffusem Eingriff reagiert. Verursachungsbeiträge und Wahrscheinlichkeiten spielen keine Rolle mehr. Kritische Nachfragen werden mit dem Hinweis pariert, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass man sich beim Theaterbesuch oder auf dem Weg dorthin infiziere. Solche Negativbeweise aber gibt es nicht. Wer so argumentiert, setzt prozessuale Errungenschaften der Aufklärung aufs Spiel. Die Hexe konnte im Hexenprozess ihre Unschuld auch nicht beweisen. Ist sie also zu Recht verbrannt worden?…
Moralisierung des Grundrechtsgebrauchs
Gerade weil die Richtung der Maßnahmen und mit ihr auch die Eingriffsdimension nun diffus geworden ist, wird eine Verhältnismäßigkeitskontrolle schwerer: Wenn keine Wirkungsketten diskutiert werden, weil der Zusammenhang zwischen Ziel und Mittel als undurchschaubar gilt („das Infektionsgeschehen kann nicht mehr nachverfolgt werden“) und Negativbeweise an seine Stelle treten („man kann sich aber theoretisch anstecken“), dann gilt auf einmal die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten als ein unsolidarischer, illegitimer Akt.
Man konnte solche Argumentationsmuster in den letzten Wochen immer wieder beobachten. So wird der Kulturszene eine peinliche pathetische Rhetorik und Bedeutungsüberschätzung vorgeworfen, wenn sie auf die Unentbehrlichkeit der Kultur hinweist, ohne zugleich Worte des Mitgefühls und der Empathie mit den Leidenden und Toten zu finden. Hier wird verfassungsrechtlich legitimer Grundrechtsgebrauch moralisiert.
Maskenlosen Demonstranten wird vorgehalten, sie spielten mit dem Leben anderer. Muss, wer die Versammlungsfreiheit betätigt, immer auch zugleich eine staatliche Schutzpflicht erfüllen? Verfassungsrechtlich eindeutig nein. Im Rechtsstaat ist es als Teil des Kundgabezwecks einer Versammlung grundsätzlich erlaubt, gegen Hygieneauflagen zu demonstrieren, indem man gegen sie verstößt. Als Studenten in den sechziger Jahren gegen die Fahrpreiserhöhung der Kölner Straßenbahn eine Kundgebung abhielten, durften sie dazu auch die Gleise am Neumarkt blockieren. Beim Demonstrieren geht es nicht um Individualismus oder Irrationalismus auf Kosten der Gemeinschaft, sondern um politischen Meinungspluralismus in einer offenen Gesellschaft. Insofern indiziert jede politische Versammlung ein Defizit im politischen Prozess oder in der massenmedialen öffentlichen Debatte…«
Bereits im April war Lepsius ein Kritiker der Grundrechtseingriffe, z.B. auf verfassungsblog.de.
(Hervorhebungen nicht im Original.)
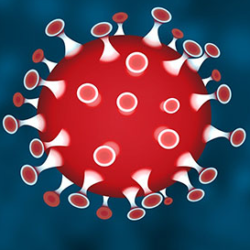
Bitte mehr davon, laut und überall!