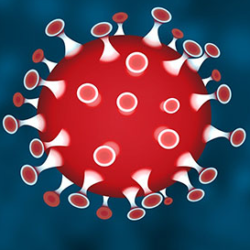»Der Coronakrise zum Trotz leisten sich Konzerne weltweit hohe Dividenden, zeigt eine Oxfam-Studie. Deutsche Firmen gingen besonders dreist vor.«
Darüber schreibt am 10.9. der Tagesspiegel.
»… Die 25 profitabelsten Unternehmen der Welt werden demnach in diesem Jahr 378 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre ausschütten – mehr als sie 2020 mutmaßlich verdienen werden. Gemessen an den absoluten Zahlen liegen dabei zwar die großen US-Konzerne von Apple bis Walmart vorne. Die deutschen Unternehmen zeichneten sich jedoch besonders "durch Dreistigkeit und Maßlosigkeit aus", schreibt Oxfam.
Als Beispiel nennt die NGO BMW. Der Autobauer hat in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro an Dividenden ausgezahlt – gleichzeitig aber Kurzarbeit eingeführt und sich öffentlich für eine staatliche Kaufprämie stark gemacht. BASF wiederum überweist Dividenden in Höhe von 3,4 Milliarden Euro, hat in Großbritannien aber eine Staatshilfe in Milliardenhöhe angenommen. Bayer will drei Milliarden Euro an seine Aktionäre zahlen, hat aber ebenfalls 670 Millionen Euro aus dem britischen Nothilfefonds kassiert.
Schweden gilt als Vorbild
Manche Länder haben diese Praxis inzwischen untersagt. In Schweden zum Beispiel erhalten Firmen kein Kurzarbeitergeld, wenn sie Dividenden an Aktionäre ausschütten. Frankreich und Dänemark halten es ähnlich. Hierzulande hingegen hat sich die Wirtschaft mit dem Argument durchgesetzt, dass Kurzarbeit keine Form von Staatshilfe ist, weil die Gelder aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung stammen…
Die NGO fordert einen Systemwechsel: "Die EU muss Unternehmen gesetzlich auf das Gemeinwohl verpflichten, um zu verhindern, dass diese weiterhin nur den Interessen der Kapitaleigner dienen."
Was Oxfam kritisiert, ist ein Wirtschaftsmodell, das über Jahrzehnte die Ökonomie geprägt hat. Formuliert hat es der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman 1970, als er schrieb: "Die soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seine Gewinne zu maximieren."…
Besonders schlimm ist die Lage in der Bekleidungsindustrie
Die NGO gibt den Konzernen deshalb eine Teilschuld daran, dass der Staat sie nun retten muss. "Viele der Unternehmen, die heute finanziell in Schwierigkeiten sind, haben erst letztes Jahr den Großteil ihrer Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet." In der Coronakrise fehlte ihnen dann das Geld. Ganz besonders gilt das laut Oxfam für die Bekleidungsindustrie. Allein die zehn größten Modemarken hätten im vergangenen Jahr zusammen 21 Milliarden Dollar für Dividenden oder Aktienrückkäufe ausgegeben. Auch deshalb hätten sie in der Coronakrise schnell Aufträge streichen müssen und Zulieferer nicht bezahlen können – mit der Folge, dass Millionen Arbeiter von Bangladesch bis Mexiko ihre Jobs verloren hätten.
Oxfam wirft den Konzernen außerdem vor, dass sie mit ihrer Unternehmenspolitik die Ungleichheit in der Coronakrise verstärken. Während Arbeiter, ihre Familien und Kleinbetriebe sich gerade so über Wasser hielten, sei es den Konzernen gelungen, sich von den wirtschaftlichen Folgen abzukoppeln oder mit der Krise sogar Gewinn zu machen. Gleichzeitig profitieren besonders die Wohlhabenden von den hohen Ausschüttungen. Während die Armen stark unter der Pandemie leiden, werden die Reichen noch reicher.
Allein die 25 reichsten Milliardäre der Welt haben ihr Vermögen von Mitte März bis Ende Mai Oxfam zufolge um 255 Milliarden Dollar vergrößert. Wie viel das im einzelnen ausmacht, zeigt das Beispiel von Amazon-Chef Jeff Bezos. Er könnte jedem seiner 876.000 Mitarbeiter einen Bonus in Höhe von 105.000 Dollar zahlen – und wäre immer noch so reich wie zu Beginn der Coronakrise, rechnet die NGO vor.
Während einerseits 400 Millionen Jobs durch die Pandemie verloren gegangen sind, steigern die 32 profitabelsten Unternehmen der Welt ihren Gewinn in diesem Jahr um 109 Milliarden Dollar. Allein auf Microsoft Google, Apple, Facebook und Amazon entfallen davon 46 Milliarden Dollar. In Europa wiederum zählen laut Oxfam Nestlé, die Deutsche Telekom und Telecom Italia zu den größten Profiteuren der Krise. "Die enormen Gewinne der Unternehmen wären kein Problem, wenn sie geteilt würden und der Rest der Gesellschaft davon profitieren würde", schreibt Oxfam. Stattdessen aber würden die 32 größten Corona-Profiteure unter den Konzernen 88 Prozent ihrer Gewinn an ihre Aktionäre ausschütten.«
Frieden, Freiheit, EU
Die Analyse von Oxfam dürfte zutreffen. Die Forderungen sind eher rührend. Von Kapitalisten zu verlangen, ihre Gewinne zu teilen, ähnelt dem an die Sonne gerichteten Wunsch, sie möge bitte im Westen aufgehen. Die EU zu mahnen, Unternehmen auf das Gemeinwohl zu verpflichten, verkennt ihren Zweck, der u.a. die "Sicherstellung eines freien und unverfälschten Wettbewerbs" umfaßt (s. Wikipedia)..
Gerade die Analyse der Geschichte der EU könnte einen Brückenschlag zwischen "Corona-KritikerInnen" und Kapitalismus-GegnerInnen ermöglichen. Erinnert sei daran, was Wikipedia zum "Vertrag über eine Verfassung für Europa" schreibt:
»Er sollte ursprünglich am 1. November 2006 in Kraft treten. Da jedoch nach gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden nicht alle Mitgliedstaaten den Vertrag ratifizierten, erlangte er keine Rechtskraft…
In Deutschland wurde ein Referendum zwar von der FDP gefordert; hierfür wäre jedoch eine Grundgesetzänderung notwendig gewesen, die von den übrigen Parteien abgelehnt wurde. Ein europaweites Referendum, wie es etwa die Europäischen Grünen vorschlugen, fand ebenfalls keine mehrheitliche Zustimmung.«
Auch in Dänemark, Irland, Portugal und Großbritannien waren Referenden geplant, deren Ausgang ungewiß schien.
Da man den europäischen Völker nicht trauen konnte, nahmen statt ihrer sich die Regierungen das Recht auf eine EU nach ihren Vorstellungen. So
»… schlossen im Dezember 2007 die europäischen Staats- und Regierungschefs unter portugiesischer Ratspräsidentschaft den Vertrag von Lissabon ab, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Ein erneutes französisches oder niederländisches Referendum im Zuge dessen fand nicht statt…«
Herausgekommen war eine Staatengemeinschaft mit einem Parlament, das keine eigenen Gesetzesvorschläge einbringen darf, in der die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, „ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern“, mit kaum kontrollierten KommissarInnen und faktisch allein entscheidenden Staats- und Regierungschefs.
Wenn der Gedanke von "Frieden und Freiheit" bei den "Corona-Protesten" sich mit einer Kritik der undemokratischen, unsozialen und militaristischen Strukturen der EU treffen könnte, wäre das eine produktive Begegnung.
(Hervorhebungen nicht in den Originalen.)