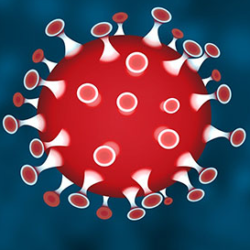Es gibt akademische Lebensläufe mit vielen Fragezeichen, die dennoch in Ruhm und Ehren gipfeln. Und es gibt andere Fälle. Einen beschreibt faz.net am 23.10. unter der Überschrift "Verletzung des Rechts: Wie Sachsens Verfassungsschutz einen Menschen kaltstellte". Dort liest man:
»… Zehn Jahre lang hatte der etwa nicht die quasi vor seiner Haustür untergetauchten Mörder der rechtsextremistischen Gruppe NSU entdeckt und stattdessen einen "Sachsensumpf" genannten Skandal herbeiphantasiert, der den Freistaat republikweit zum Gespött machte.
Angesichts dessen wundert ein neuerlicher Fall, der nun zum Nachteil des Landes ausging, kaum: Vor dem Oberlandesgericht Dresden stimmte der Freistaat nach langem Prozess und dringender Empfehlung durch die Richter einer Schadenersatzzahlung über 145.000 Euro an einen Bürger zu, dessen Existenz Mitarbeiter des Verfassungsschutzes beinahe vernichtet hätten. Die Entscheidung selbst und vor allem die Höhe der Summe dürften bundesweit einmalig sein, über die Gründe aber schweigen sowohl der Verfassungsschutz als auch das Innenministerium beharrlich.
Der Geschädigte Omar B., ein Mann heute mittleren Alters, der mit seinem richtigen Namen nicht in der Öffentlichkeit auftauchen will, kommt vor 20 Jahren aus dem Nahen Osten nach Sachsen, absolviert an einer Universität ein naturwissenschaftliches Studium, promoviert und hat eine wissenschaftliche Karriere vor sich. Zunächst arbeitet er bundesweit mit Jahresverträgen und hat 2010 in Sachsen, wo er mit seiner Frau lebt, einen Dreijahresvertrag an einer Universität in Aussicht, für den sich auch sein früherer Institutsleiter starkmacht. Kurz vor der Unterzeichnung jedoch lehnt die Universitätsleitung auf einmal ohne Begründung ab. Der Institutsleiter, der den Mann halten will, beschäftigt ihn daraufhin an einer befreundeten Einrichtung, wo B. noch in der Probezeit gekündigt wird. Auch die Vermittlung an ein Forschungsinstitut in einer anderen Stadt, wohin er nun mit seiner Familie umzieht, endet mit einer begründungslosen Kündigung in der Probezeit.
B. und seine wissenschaftlichen Förderer sind ratlos. An seiner Arbeit, da sind sie sich sicher, kann es nicht liegen. Bitten um Begründungen lehnen alle Arbeitgeber ab, sie müssen diese in der Probezeit auch nicht geben. B. aber, der inzwischen drei schulpflichtige Kinder hat, steht nun arbeitslos und ohne Einkommen da. Er schreibt, so schildert es sein Rechtsanwalt, mehr als 100 Bewerbungen, die wegen der nicht plausiblen Kündigungen jedoch erfolglos bleiben, arbeitet dann prekär selbständig, um sich und seine Familie über Wasser zu halten. Vor allem aber will er wissen, warum ihm mehrfach gekündigt wurde, auch um sich endlich dagegen wehren zu können. Eine unbegrenzte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis besitzt B. längst, und als Nachfragen bei Ausländerbehörde und Ausländerbeauftragtem ergebnislos bleiben, wendet er sich an die Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag, die ihn an den Datenschutzbeauftragten verweist. Inzwischen sind fünf Jahre ins Land gegangen.
Der Datenschutzbeauftragte findet eine Spur
Der Datenschutzbeauftragte lässt den Fall untersuchen – und wird beim Verfassungsschutz fündig. Er kann B. jedoch nur eine zum Großteil geschwärzte Auskunft erteilen. Immerhin ist darin zu erfahren, dass Mitarbeiter des Verfassungsschutzes B. bei seinen tatsächlichen und potentiellen Arbeitgebern hinter seinem Rücken angeschwärzt haben. Der Anlass dafür waren offenbar Besuche sowie seine gelegentliche Tätigkeit als Vorbeter im "Arbeitskreis muslimischer Studenten", den es damals offiziell an der Universität gab und dem das Rektorat sogar Räume zur Verfügung gestellt hatte. Obwohl der Verfassungsschutz offenbar keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährdung feststellte – weshalb er der Ausländerbehörde auch keine Verwehrungsgründe für die Daueraufenthaltserlaubnis mitteilte –, warnte er die Arbeitgeber mündlich vor dem Betroffenen, der angeblich radikal sowie ein Extremist und Hauptdrahtzieher sei, weshalb diese sich von ihm trennen müssten.
Die Gründe dafür liegen bis heute im Dunkeln. B. ist weder vorbestraft noch kriminell in Erscheinung getreten. Dennoch forderten die Verfassungsschützer die Universitäts- und Institutsleitungen explizit auf, über die Gespräche strengstens zu schweigen, obwohl diese B. mindestens hätten mitteilen müssen, dass sie seinetwegen mit dem Geheimdienst in Kontakt standen. Sachsens Datenschutzbeauftragter Andreas Schurig sieht in diesen "rechtswidrigen Übermittlungen", die es drei Jahre lang gab, einen klaren Rechtsverstoß, auf den er mit dem vergleichsweise scharfen Mittel einer Rüge reagierte und dem Fall im Jahresbericht 2017 vier Seiten widmete…
B. allerdings will nun noch wissen, was die Verfassungsschützer einst anderen über ihn erzählten, und hat deshalb vor dem Verwaltungsgericht in Dresden auf Auskunft geklagt. Er glaubt, dass das Amt ihm gegenüber zumindest die Daten offenlegen muss, die es auch seinen Arbeitgebern übermittelt hat. Der Verfassungsschutz und das Innenministerium sträuben sich dagegen mit aller Macht. Der Prozess ist noch anhängig, aber sollte das Gericht B.s Auffassung folgen, wäre das wohl rechtliches Neuland, hat doch ein Geheimdienst schon im Namen stehen, dass er seine Informationen nicht öffentlich zu Markte trägt.
Für Rechtsanwalt Thomas Giesen, der mal Sachsens Datenschutzbeauftragter war und B. in dem Verfahren vertritt, ist die Sache klar: "Das Amt kann nicht auf Geheimhaltung bestehen, wenn es bereits den Arbeitgebern meines Mandanten geheime Informationen weitergegeben hat", sagt er…«